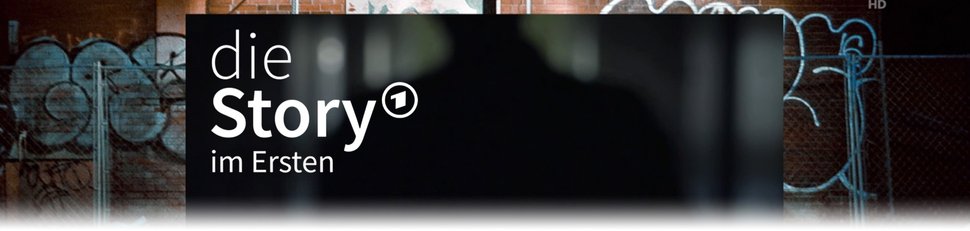Staffel 11, Folge 35–64
453. Liken. Hassen. Töten. – Wie Jugendliche zu Terroristen werden
Staffel 11, Folge 35William, 21 Jahre – erschießt in den USA zwei Mitschüler an seiner High-School.
David, 18 Jahre – ermordet in München neun Menschen an einem Einkaufszentrum.
Paul (Name geändert), 15 Jahre – will in Deutschland seine Schule in die Luft jagen.
In dieser Doku geht es nicht nur um diese drei Jugendlichen mit gefährlichen Mordfantasien. Es geht darum zu verstehen, warum viele grauenvolle Anschläge auf der ganzen Welt ausgerechnet auf das Konto Heranwachsender gehen und wie ihre skrupellosen Anschlagsfantasien überhaupt entstehen.
Auf den Spiele- und Chat-Plattformen Steam und Discord gibt es hunderte Games zum Download. Jeden Tag spielen dort bis zu 50 Millionen Menschen. Nebenbei schreiben sie miteinander. Oft sind ihre Nachrichten harmlos, doch in manchen Gruppen radikalisieren sie sich gegenseitig mit Hass gegenüber Ausländern und Juden. Vereint in ihrer Faszination für Gewalt. Darin 2016: der Münchner Attentäter, der am OEZ neun Menschen ermordete. Heute dabei: Jugendliche mit gefährlichen Anschlagsfantasien.
Die jungen Autoren Alexander Spöri und Luca Zug (beide 20) beschäftigen sich schon seit dem OEZ-Anschlag 2016 mit dem Thema. Sie wollen wissen: Wie geraten junge Menschen, so alt wie die Filmemacher selbst, in diese Spirale der Gewalt? Mit einem Undercover-Account schleusen sie sich ein – in diese dunkle Welt der Gewalt. Sie stoßen auf Amok- und Terror-Gruppen, in denen Jugendliche noch heute radikales Gedankengut verbreiten und Anschläge planen. Sie treffen u. a. einen jungen Mann, der 2016 mit dem OEZ-Attentäter in Kontakt steht und damals plant, seine eigene Schule in die Luft zu sprengen.
Mit ihrer Doku wollen die jungen Journalisten das Bewusstsein für diese neue Art der jugendlichen Radikalisierung stärken. Nur wenn man die Gefahr anerkennt, kann man möglicherweise künftige Anschläge verhindern. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 18.07.2022 Das Erste 455. Afghanistan – Ein Jahr später – Mission Kabul-Luftbrücke
Staffel 11, Folge 37Ein Jahr nach dem Fall von Kabul blickt der Film auf die afghanische Zivilgesellschaft und zeigt Menschen, die trotz allem entschlossen sind zu bleiben. Er erzählt aber auch von denen, die gezwungen sind, zu gehen. Wie hat sich das Land verändert? Und welche Anstrengungen unternehmen Bundesregierung und NGOs für diejenigen, die besonders schutzbedürftig sind und nicht bleiben können?
Dieser Film dokumentiert mit exklusiven filmischen Beobachtungen ein sich nach der Machtübernahme der Taliban stetig veränderndes Land, das vielen Afghaninnen und Afghanen keinen Spielraum mehr lässt, frei zu leben. Er zeigt Menschen, die dennoch versuchen, sich ein Stückchen ihrer Normalität zu erhalten – oft unter großen Gefahren. Und die Dokumentation erzählt von denen, die gezwungen sind zu fliehen. Der Weg raus aus Kabul nach Deutschland gelingt vielen schutzbedürftigen Frauen, Männern und Kindern nur dank des Engagements der Freiwilligen-Organisation „Kabul-Luftbrücke“. Gegründet von einer Handvoll Journalistinnen und Aktivisten, die für die Zivilgesellschaft erfolgreich Menschen evakuieren. Denn eine Aufnahmezusage durch die Bundesregierung ist noch kein Ticket in die Freiheit. Ohne Reisepass, Visum und vor allem eine sichere Passage geht nichts. Genau hier hilft „Kabul-Luftbrücke“. Kann dieses Engagement der Zivilgesellschaft als Blaupause für künftige humanitäre Krisen dienen? (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 08.08.2022 Das Erste 457. Der Fall von Kabul – Chronik eines Desasters
Staffel 11, Folge 39Im August 2021 schaute die Welt entsetzt nach Afghanistan: Innerhalb kürzester Zeit brach der Staat zusammen, der 20 Jahre lang vom Westen unterstützt worden war. Noch vor dem Abzug der letzten US-Truppen marschierten die Taliban in die Hauptstadt ein, viel früher als vorhergesagt. Die reguläre Regierung floh. Tausende Afghaninnen und Afghanen, die das Land verlassen wollten, strömten zum Flughafen – in Panik und Todesangst. Wie konnte es so weit kommen?
„Ich bin immer noch traumatisiert. Ich kann immer noch nicht akzeptieren, was in meinem Land passiert.“ Zarifa Ghafari war eine der wenigen Politikerinnen in Afghanistan und eine der jüngsten. „Ich musste das Ergebnis von 26 Jahren Arbeit zurücklassen, meine Zeugnisse, Diplome, Auszeichnungen – alles.“ Als die Taliban wieder die Macht übernahmen, war sie auf einmal in Lebensgefahr, so wie Tausende Afghaninnen und Afghanen, die mit westlichen Organisationen zusammengearbeitet oder sich für einen westlichen Lebensstil entschieden hatten. Viele von ihnen hofften auf eine Evakuierung ins sichere Ausland, oft vergebens.
Autoren von WDR und NDR haben den dramatischen Fall von Kabul rekonstruiert und dazu mit Beteiligten, Verantwortlichen und Augenzeugen gesprochen. Erstmals seit der Eroberung der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die Taliban geben Bundeswehrsoldaten des „Kommando Spezialkräfte“ detailliert Einblick in die bislang größte Evakuierungsmission der Bundeswehr im Ausland. Der für diesen Einsatz verantwortliche Kommandeur Jens Arlt beschreibt die ungeheuer schwierigen Rahmenbedingungen; er betont, „dass das Bild, das man aus dieser Operation porträtiert hat, nicht das Bild ist, was real dort unten passiert ist.“ Ein Rettungstruppführer fasst seine Eindrücke der zehn Tage am belagerten Flughafen von Kabul so zusammen: „Ich könnte mich jetzt an keinen Film erinnern, der annähernd das beschreiben würde, was wir dort erlebt haben.“
Mitglieder der ehemaligen afghanischen Regierung schildern den dramatischen 15. August 2021 und was an diesem Tag im Präsidentenpalast passierte. „Wir dachten am Morgen nicht, dass das unser letzter Tag in Kabul sein wird“, erinnert sich Hamdullah Mohib, damals Nationaler Sicherheitsberater. Er entschied sich, mittags zusammen mit dem Präsidenten überraschend das Land zu verlassen und so den Sturz der Regimes zu besiegeln. Markus Potzel, der eigentlich im Sommer 2021 zum zweiten Mal Botschafter in Kabul werden sollte, kam an diesem 15. August nicht ans Ziel, sondern wurde nach Doha geschickt, wo die Taliban-Führer ihr Hauptquartier hatten.
Von dort aus beobachtete und begleitete Potzel die dramatische Phase der Machtübernahme in Afghanistan und die Evakuierungsmission am Flughafen von Kabul. In großer Offenheit schildert er die fatalen Fehleinschätzungen der deutschen Politik und Diplomatie – und die entscheidenden Fehler des Doha-Abkommens, das unter US-Präsident Trump mit den Taliban geschlossen wurde und das zum katastrophalen Ende des 20-jährigen Afghanistan-Krieges führte.
Die Story „Der Fall von Kabul – Chronik eines Desasters“ liefert auf der Basis von vertraulichen Dokumenten, unveröffentlichtem Filmmaterial der Bundeswehr und exklusiven Interviews mit Diplomaten, Soldaten und Politikern eine genaue Rekonstruktion der dramatischen Ereignisse im August 2021. Und er gibt Antworten auf Fragen, die bis heute aktuell sind: Was ist wann falsch gelaufen? Wo liegt das Versagen – und wer übernimmt die Verantwortung dafür? (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 15.08.2022 Das Erste 464. Die große Dürre – Was tun, damit Deutschland nicht austrocknet?
Staffel 11, Folge 46Deutschland bereitet sich auf Dürren vor, Bauern kämpfen gegen die Trockenheit, Notfallpläne werden erarbeitet. Wie lange reicht unser Wasser noch? Dieser Frage geht Filmemacher Daniel Harrich gemeinsam mit einem Forscherteam nach. Bundesweit haben ihnen Menschen gemeldet, wo Bäche und Teiche verschwinden – insgesamt mehr als 1.100 Gewässer. Selbst der Rhein könnte ein Rinnsal werden. Wie entwickeln sich die Grundwasserspiegel? Werden wir Hirse anbauen statt Weizen? Viele heimische Pflanzen- und Tierarten, die sich nicht schnell genug anpassen, werden aussterben. Wir müssen also radikal umdenken. Bislang haben wir nur die Entwässerung unserer Städte und Felder geplant, jetzt müssen wir das Wasser in der Fläche halten. Wir werden uns an den Wassermangel in Deutschland anpassen müssen, unsere Landwirtschaft umstellen, anders bauen, unser Leben verändern. Die Doku zeigt, was die Dürren in Deutschland für uns bedeuten werden und wie kostbar unser Wasser noch werden wird. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 29.08.2022 Das Erste 465. Elon Musk – Tech-Titan
Staffel 11, Folge 47Milliardär, Visionär, Erfinder – Superheld oder Scharlatan? Kaum jemand polarisiert so wie Elon Musk. Das extravagante Mastermind hinter Tesla und SpaceX beeinflusst mit provokanten Tweets die Aktienmärkte und verfügt über enormen Reichtum und Einfluss. Doch was treibt ihn an? Hat dieser Tech-Titan den Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft oder führt er uns gar in ein multiplanetares Zeitalter?
Kaum eine Figur unserer Zeit spaltet die öffentliche Meinung so sehr wie Elon Musk. Das extravagante Mastermind hinter Tesla und SpaceX lässt mit einzelnen Tweets die Aktienmärkte verrücktspielen, seine kontroversen PR-Auftritte lassen manche Experten an seinen wahren Motiven zweifeln. Durch globalisierte Möglichkeiten und universelle technische Reichweiten verfügt Musk über einen Reichtum und Einfluss, der jenen der meisten Nationen und demokratisch gewählten Staatsoberhäupter bei Weitem übersteigt. Mit seinem eigenen Satellitensystem Starlink hat er nun sogar unseren Nachthimmel umgestaltet. Doch wer ist Elon Musk wirklich? Was treibt ihn an, was motiviert ihn? Hält dieser Tech-Titan den Schlüssel zu einer nachhaltigen, e-mobilisierten Zukunft unserer Welt seinen Händen – oder führt er die Menschheit gar in ein neues, multiplanetares Zeitalter? (Text: ARD)Deutsche Online-Premiere Mi 24.08.2022 ARD Mediathek Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 31.08.2022466. Wie viel Geld bringt ein Frühchen? – Warum Kliniken in Deutschland Gewinne machen (müssen)
Staffel 11, Folge 48 (45 Min.)Dieser Film zeigt: Viel zu oft geht es im Krankenhaus nicht um das Wohl der Patienten, sondern um Geld. Besonders deutlich wird das in zwei Bereichen, in denen es buchstäblich um Leben und Tod geht: bei der Behandlung von Frühgeborenen und schwer kranken Intensivpatienten.
Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, ist das häufig ein Notfall. Aus medizinischer Sicht sollten Krankenhäuser alles tun, um eine Frühgeburt zu vermeiden. Doch die oft schwierige Verlängerung der Schwangerschaft bringt den Kliniken kaum Geld ein – die Behandlung von Frühchen dagegen ist äußerst lukrativ. Je früher ein Kind zur Welt kommt und je weniger es wiegt, desto mehr Geld überweist die Krankenkasse dem Krankenhaus. Oft sind es mehr als 100.000 Euro – pro Kind. Auch auf der Intensivstation spielt Geld eine entscheidende Rolle:
Betriebswirtschaftlich lohnt es sich für eine Klinik, Patienten möglichst lange zu beatmen, länger als es medizinisch sinnvoll wäre. Denn wenn eine bestimmte Zeitschwelle überschritten wird, gibt es deutlich mehr Geld.
Kinder werden früher auf die Welt geholt, schwerstkranke Patient:innen länger beatmet, um Geld zu verdienen? Was undenkbar klingt, ist unter Insidern, Ärzten und Pflegepersonal längst bekannt. Verantwortlich für die Missstände ist unser System der Krankenhausfinanzierung. Anders als Feuerwehr und Polizei, bekommen Kliniken kein Geld dafür, dass sie da sind und helfen, wenn sie gebraucht werden. Sie werden pro Patient bezahlt. Vor allem aufwendige Behandlungen und Operationen bringen Gewinne ein.
Filmautorin Claudia Ruby hat Ärztinnen, Ärzte und Pflegende gefunden, die erschütternde persönliche Erlebnisse preisgeben: Sie berichten davon, wie sie unter Druck gesetzt werden, damit sie unnötige Therapien und Operationen anordnen oder durchführen.
Der Film beleuchtet die Folgen unseres Finanzierungssystems im Krankenhaus anhand der Situation auf Frühchen- und Intensivstationen. Er zeigt, warum die Probleme zu eskalieren drohen und berichtet von möglichen Lösungsansätzen, die Fachleute im Auftrag der Bundesregierung zurzeit erarbeiten. Nicht zuletzt gibt er verzweifelten Ärztinnen und Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern eine Stimme. Sie alle möchten in Krankenhäusern arbeiten, in denen die Gesundheit an erster Stelle steht – und nicht das Geld. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 05.09.2022 Das Erste Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 18.07.2022, dann für den 15.08.2022468. Tabletten gegen Depressionen – helfen Antidepressiva?
Staffel 11, Folge 50 (45 Min.)Ärztinnen und Ärzte verordnen jedes Jahr Antidepressiva in einer Menge, die ausreicht, 80 Millionen Einwohner in Deutschland für mehr als einen halben Monat zu versorgen. Die Verschreibungszahlen haben sich seit 1990 verachtfacht, obwohl es immer wieder Zweifel an der Wirksamkeit von Antidepressiva gibt. Bereits 2008 zeigte eine groß angelegte Studie, dass die Wirksamkeit dieser Medikamente nur wenig über der von Placebos liegt. Und gerade fand eine Studie der Amerikanischen Arzneimittelbehörde heraus, dass nur etwa 15 % der Erkrankten von den Medikamenten profitieren, bei 85 % wirken sie nicht stärker als ein Placebo. Sind also Antidepressiva das richtige Heilmittel für die kranke Psyche?
„Die Tabletten sind für mich seit vielen Jahren treue Begleiter bei der Bewältigung meiner Depressionen.“ Christine (52) hat ihren Job als Behördenleiterin durch die Depression verloren, war sieben Mal in psychiatrischen Kliniken und sagt heute: „Es ist mir egal, was Studien sagen, ich spüre, dass meine Medikamente wirken.“
Was machen die Medikamente in ihrem Körper? Die meisten Antidepressiva verändern den Spiegel von bestimmten Botenstoffen im Gehirn, vor allem von Serotonin. Lange dachte man, dass ein zu niedriger Serotoninspiegel, die Depression auslöst – mittlerweile ist diese These widerlegt. Was bei einer Depression im Gehirn passiert, haben Wissenschaftler und Ärzte bis heute nicht wirklich verstanden – dem Verkaufserfolg der Antidepressiva tut das keinen Abbruch. Wie also können die Pillen Christine helfen?
Mary (42) verflucht den Tag, an dem sie angefangen hat, Antidepressiva zu nehmen: „Sie haben mein Leben nicht verbessert, sondern erheblich verschlechtert.“ Seit vier Jahren dosiert Mary die Tabletten in kleinen Schritten runter, aber ihr Körper rebelliert dagegen. „Diese Absetzprobleme werden bislang total unterschätzt“, sagt Professor Tom Bschor, einer der führenden Antidepressiva-Experten in Deutschland. Wer die Tabletten über längere Zeit nehme, käme oft nur noch schwer von ihnen los. Auch das, vermutet Bschor, dürfte ein Grund dafür sein, warum immer mehr Antidepressiva genommen werden.
Professor Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe sieht in den Medikamenten ein wirksames Werkzeug gegen Depressionen: „Der Effekt von Antidepressiva zeigt sich im Versorgungsalltag. Da können sie beobachten, wie die Mittel wirken. Das ist meine klinische Erfahrung“, sagt Hegerl.
Helfen Tabletten gegen Depressionen? Und welchen Preis zahlen die Patienten und Patientinnen? Wieso kann ein Medikament, das so umstritten ist, so erfolgreich sein? (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 12.09.2022 Das Erste Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 19.09.2022469. Der Documenta Skandal
Staffel 11, Folge 51„Kunstmesse der Schande!“ titelt die BILD-Zeitung. „Willkommen bei der Antisemita15“ schreibt der SPIEGEL. Und wann wird schon einmal stundenlang im Bundestag über eine Ausstellung gestritten? Die Documenta15 ist zum Politikum geworden – und gleichzeitig durchaus erfolgreich beim Publikum. Gerade bei den Jüngeren.
Ein 100 Quadratmeter großes Banner mit antisemitischer Motivik eines indonesischen Kollektivs war der Katalysator, weitere als judenfeindlich lesbare Werke sind dazugekommen. Nicht nur jüdische Menschen in Deutschland sind massiv irritiert und schockiert. Aber längst geht es nicht mehr um einzelne problematische Beispiele, sondern um Fragen, die weit über die Ausstellung hinausweisen: Wo beginnt Antisemitismus, wo hört Israelkritik auf? Darf man in Deutschland die Politik Israels kritisieren? Und wer darf das wie? Gibt es in der Kunst- und Kulturszene einen schleichenden Boykott jüdischer oder israelischer Positionen? Wo kommen rechte Stereotype zum Tragen? Welche Rolle spielt die Anti-Israel-Boykottbewegung „BDS“? Und wie wollen wir in einer multikulturellen Gesellschaft Erinnerungskultur leben?
Der Film „Der Documenta Skandal“ erforscht nicht nur die Ereignisse auf der Kasseler Weltkunstausstellung, sondern auch eine erbitterte, wütend und äußerst polarisiert geführte Debatte. Eine spezifisch deutsche Debatte. Eine Debatte, die ins Herz der deutschen Staatsräson zielt. Eine Debatte, in der an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnert wird.
In ihrem ersten TV-Interview spricht mit uns die Künstlergruppe „Taring Padi“, verantwortlich für das große Banner „People’s Justice“, das tagelang im Herzen Kassels zu sehen war. Des Weiteren sprechen wir mit Claudia Roth, dem Zentralrat der Juden, Eva Menasse, Igor Levit, Meron Mendel und anderen. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 19.09.2022 Das Erste 470. Wie weiter, SPD? – Das erste Jahr als Kanzlerpartei
Staffel 11, Folge 52Für die SPD war es ein Jahr auf der Achterbahn. Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl 2021 war die Euphorie groß. Doch die Träume vom „sozialdemokratischen Jahrzehnt“ wurden rasch enttäuscht: Niederlagen bei Landtagswahlen und ein Krieg in Europa. Wie geht’s weiter mit der Kanzlerpartei?
Am 26. September 2021 gewann die SPD durchaus überraschend die Bundestagswahl. Nach Jahren interner Zerwürfnisse, nach einer gefühlten Ewigkeit als Juniorpartnerin von Dauerkanzlerin Angela Merkel, nach meist chronisch schlechten Umfragewerten wurde die SPD plötzlich Kanzlerpartei. Die Vorsitzenden prophezeiten den Anbruch eines „sozialdemokratischen Jahrzehnts“. Die neue Bundestagsfraktion war größer, jünger, linker, diverser. Die Euphorie war groß – dann begann ein für die Partei ein Jahr wie eine Achterbahnfahrt: Absolute Mehrheit im Saarland, bittere Niederlagen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Der Aufbruch in die Ampelkoalition mit großen politischen Versprechungen. Russlands Überfall auf die Ukraine, das Ende außenpolitischer Gewissheiten, die Zeitenwende und die Frage nach Versagen und Fehlern in der Vergangenheit.
Genau ein Jahr nach dem Wahlsieg erzählt dieser Film von einer Partei, die den Weg in die Zukunft gefunden zu haben glaubte und sich plötzlich doch völlig neu sortieren muss. Die Autoren begleiten die Parteispitze durch die Wahlkämpfe des Jahres 2022 bis hin zum niedersächsischen Landtagswahlkampf. Sie beobachten junge Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion auf der Suche nach neuer Orientierung. Sie spüren in Ortsvereinen nach, ob die Basis die eigene Partei noch wiedererkennt. Und natürlich kommt auch Bundeskanzler Scholz zu Wort, spricht über sein Verhältnis zu seiner Partei. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 26.09.2022 Das Erste 472. Weizen als Waffe – Lebensmittelverknappung im Krieg
Staffel 11, Folge 54 (45 Min.)Über unseren Kopf rauschen täglich die Raketen, der Alarm hört nicht auf. Aber mehr Sorgen machen wir uns, wenn es still wird, dann kann es sein, dass eine Rakete hier einschlägt.““ Nadja leitet einen 4.000 Hektar großen Betrieb in der Nähe von Mykolajiw, jetzt lenkt sie ihren Traktor durch die Granathülsen, die auf ihrem Acker liegen. Für sie und für viele andere Landwirte in der Ukraine bedeutet der Krieg nicht nur tägliche Lebensgefahr, wenn sie ihre Felder bestellen – sie müssen auch den Gedanken ertragen, dass in ihren Silos Getreide vergammelt, während in anderen Teilen der Welt Hunger herrscht.
Die russische Invasion in die Ukraine verursacht weltweit Versorgungsrisiken. Besonders gefährdet ist die Ernährungssicherheit in Afrika. Denn gerade hier ist man existentiell von Weizenimporten abhängig. Geschlossene und zerbombte Häfen in der Ukraine, zerstörte Brücken und verminte Felder führen dazu, dass die fragile globale Lieferkette zerbricht. Als Folge davon haben immer mehr Menschen in den Ländern des globalen Südens keinen Zugang zu Nahrung.
„Wir haben Hunger“, sagen uns die jungen Männer auf dem Markt von Nouakchott in Mauretanien. „Wenn sich die Situation mit dem Beginn des Jahres nicht ändert, werden wir alle Salafisten werden.“ Während in Europa die Angst vor Hungersnöten auf dem afrikanischen Kontinent oder gar Migrationsströmen wächst, nutzt Putin die angespannte Situation für das eigene Narrativ. Demnach seien die westlichen Sanktionen Ursache für die drohende Hungersnot. Dient diese Erzählung dazu, neue Verbündete gegen den Westen zu gewinnen? An den Börsen erreicht der Weizenpreis ein historisches Hoch von über 500 Dollar je Tonne.
Eine fatale Entwicklung, denn aufgrund der hohen Preisen können arme Länder sogar das vorhandene Getreide kaum mehr finanzieren. Es droht eine globale Abwärtsspirale. Wie konnte es so weit kommen, dass Weizen als politisches Druckmittel eingesetzt werden kann? Was hat uns in eine so große Abhängigkeit gebracht? Und wie können wir die Versorgungslage vor allem für die ärmsten Länder verbessern? (Text: WDR)Deutsche TV-Premiere Mo 10.10.2022 Das Erste 473. Vertreibung als Waffe? – Wie Flüchtlinge Teil der Kriegsführung werden
Staffel 11, Folge 55 (45 Min.)Vika ist mit ihrem vierjährigen Sohn aus Tschernihiv geflohen und lebt jetzt in Deutschland.
„Mein Leben ist am 4. März zu Ende gegangen“, erzählt sie, „als mein Haus verbrannt ist. Da gibt es nichts mehr.“ Viermal ist sie innerhalb der Ukraine umgezogen – doch irgendwann ging es auch dort nicht mehr. Nun lebt sie in Deutschland und ist auch hier schon etliche Male umgezogen, auf der Suche nach Sicherheit. Vika ist eine von Millionen Flüchtenden aus der Ukraine, die in die EU gekommen sind. Der UNHCR spricht von der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Angriff Russlands auf die ganze Ukraine ist eine Zeitenwende auch im Hinblick auf die Themen Flucht und Vertreibung.
Politiker und Experten sehen nicht nur die Herausforderung, die Flüchtenden unterzubringen und später zu integrieren. Gerald Knaus, der sich seit Jahren intensiv mit Migration und Flucht beschäftigt, formuliert es so: „Ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass die Europäische Union sich nicht auseinanderdividieren lässt. Dass es Putin nicht gelingt, die ukrainischen Flüchtlinge zu dem zu machen, als das er sie sieht, nämlich eine Waffe gegen Europa.“
Nutzt die russische Führung Vertreibung und die Angst vor Fluchtbewegungen, um den Westen zu schwächen? Werden Flucht und Vertreibung – neben Desinformation und der Verknappung von Energie und Getreide – bewusst als Waffe eingesetzt? Sind sie Bestandteil hybrider Kriegsführung? Um innerhalb der EU, innerhalb der westlichen Länder Unruhe zu stiften?
In anderen Konflikten wurden Flüchtlinge bereits gezielt als Druckmittel eingesetzt, um den Gegner zu schwächen. Beispielsweise vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der im Sommer und Herbst 2021 versuchte, die EU mit syrischen, afghanischen und afrikanischen Flüchtlingen an der polnischen Grenze zu erpressen
Die Story „Vertreibung als Waffe?“ dokumentiert und analysiert die Entwicklungen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und zieht Parallelen zur „Instrumentalisierung“ von Flüchtenden aus der arabischen Welt. Sie spricht mit politisch Verantwortlichen und mit Flüchtlingen, über die aktuellen Herausforderungen und mögliche Lösungen. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 17.10.2022 Das Erste 475. Russland, Putin und wir Ostdeutsche
Staffel 11, Folge 57Der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gilt als Zeitenwende – auch in Bezug auf das Verhältnis zu Russland. Letzteres ist vor allem für die Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, ein großes Thema. ARD-Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer unternimmt für diesen Film eine sehr persönliche Reise durch den Osten Deutschlands.
Der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gilt als Zeitenwende – in Bezug auf die Bundeswehr, die Rolle Deutschlands in Europa und in Bezug auf das Verhältnis zu Russland. Letzteres ist vor allem für die Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, ein großes Thema. Was für viele im Westen die USA, war für viele im Osten die Sowjetunion: „der große Bruder“. Doch der Überfall Russlands auf die Ukraine stellt alte Gewissheiten in Frage und wirbelt Überzeugungen durcheinander. Er bricht politische Biografien, zieht sich wie ein Riss durch Lebensläufe, durch Familien und Freundeskreise.
Gleichzeitig zeigen viele Menschen im Osten trotz Putins Angriffskriegs noch immer ein gewisses Verständnis für Russland, wie Umfragen immer wieder belegen.
Wie prägt der Krieg die Haltung der Ostdeutschen gegenüber Russland? Woher kommen Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Ost und West? Und was sagt das über Gräben aus, die in der deutschen Bevölkerung auch über 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch existieren?
In „Russland, Putin und wir Ostdeutsche“ unternimmt die ARD-Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer eine sehr persönliche Reise durch den Osten Deutschlands. Auch in ihrer Familie hat der russische Angriffskrieg für viele Diskussionen gesorgt. Ihre Mutter war Russischlehrerin und die russische Literatur und Musik faszinieren sie bis heute.
Jessy Wellmer besucht ihre Eltern in ihrer Heimatstadt Güstrow und trifft auf Freunde der Familie, die alle ihren ganz eigenen Blick auf den Krieg und Russland haben. Sie fährt nach Lubmin, wo die Nord-Stream-2-Pipeline anlandet und viele Menschen, wie der örtliche SPD-Chef Frank Tornow, es am besten fänden, wenn die Pipeline doch noch in Betrieb genommen würde. Sie begegnet Politikern wie Linken-Urgestein Gregor Gysi, der mit sich und seiner Partei hadert, weil sie lange Russland positiv und gar als Friedensmacht gesehen hat und manche seiner Genossen dies bis heute tun. Sie trifft auf einen ehemaligen NVA-Offizier und besucht den Gitarristen der legendären DDR-Rockband Silly, Uwe Hassbecker, der bis zum Krieg Putin in Diskussionen mit Freunden und Bekannten verteidigte und jetzt angesichts des Krieges entsetzt und enttäuscht ist.
Und schließlich spricht Jessy Wellmer mit Wissenschaftlerinnen wie der ehemaligen DDR-Leichtathletin Ines Geipel und der Historikerin Silke Satjukow darüber, warum der Osten in Sachen Russland so anders tickt als der Westen.
Die Reportage liefert eine spannende Auseinandersetzung mit dem Russlandbild der Ostdeutschen, die medial bisher so noch nicht stattgefunden hat. Teil des Films wird auch eine eigens für die Dokumentation in Auftrag gegebene Infratest-dimap-Umfrage zum Russland-Bild in Ost- und Westdeutschland sein. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 24.10.2022 Das Erste Deutsche Online-Premiere Sa 22.10.2022 ARD Mediathek 476. Schmutziges Kupfer – Die dunkle Seite der Energiewende
Staffel 11, Folge 58Eine spannende Recherche über Kupfer, einen der wichtigsten Rohstoffe für erneuerbare Energien.
Die Energiewende war vielleicht noch nie wichtiger als heute. Windenergie und Solarpower sind entscheidend für die Zukunft. Der vielleicht wichtigste Rohstoff für diese Schlüsseltechnologien ist das Metall Kupfer. Seit Jahren steigt der Preis für Kupfer in noch nie dagewesene Höhen. Minen und Produzenten machen weltweit Milliardengewinne.
Doch wo und unter welchen Umständen wird Kupfer abgebaut? Welche Folgen hat der Abbau für die Umwelt? Ein Team des NDR stößt auf eine ökologische Katastrophe.
Der Hamburger Konzern Aurubis ist der größte Kupferproduzent Europas. Mehr als 350 Millionen Euro Gewinn machte Aurubis 2020/2021 mit dem Edelmetall. Trotz Coronapandemie verbuchte die Firma so das beste Ergebnis der Firmengeschichte. Über eine Million Tonnen Kupfer werden von rund 7000 Beschäftigten weltweit produziert. Das Erz für seine Schmelzöfen bezieht Aurubis direkt aus den Abbauländern. Chile ist einer der großen Lieferanten. Doch der Abbau dort verursacht immenses Leid. Aurubis verweist auf hohe Standards in ihren Lieferketten und einen Verhaltenskodex, den alle Geschäftspartner befolgen müssten.
Das NDR-Team recherchiert in Chile, einem Land mit riesigen Kupfervorkommen. Ganz im Norden in der Provinz Chuquicamata befindet sich der größte Kupferbergbau der Welt. Er liegt in der Atacama-Wüste, einem der trockensten Orte der Erde. In gigantischem Ausmaß wird hier der Boden aufgerissen, um das wertvolle Metall zu gewinnen. Obwohl es hier kaum regnet, verschlingt die Grube Unmengen an Wasser, um das Kupfer zu gewinnen. Eine ökologische Katastrophe. Die Dörfer der Menschen, die in der Umgebung leben, werden schlicht ausgetrocknet und der Rest des Wassers mit Schwermetallen kontaminiert. Das schreckliche Ergebnis ist eine Krebsrate, die fünf bis sechsmal höher ist als sonst im Land.
Da die Kupferpreise so sehr steigen, wird nun überlegt, auch in Deutschland wieder Kupfer abzubauen. In der Lausitz werden große Vorkommen vermutet. Die geschätzten 130 Millionen Tonnen sollen in den nächsten Jahrzehnten gewonnen werden. Doch kann man Kupfer überhaupt umweltfreundlich abbauen?
Der Schlüssel dazu liegt vielleicht in Kanada. Das Land um die Kupferminen von Ontario galt in den 1970er-Jahren als das am meisten vergiftete Gebiet in ganz Nordamerika. Die Flüsse und Seen waren praktisch tot und die einstigen Wälder glichen einer Mondlandschaft. Mit viel Aufwand und moderner Technologien ist es den Kanadiern gelungen, die Landschaft zu heilen, neue Wälder zu schaffen und die Gewässer wieder von Schwermetallen zu befreien. Noch immer wird hier Kupfer gefördert, mittlerweile jedoch so umweltfreundlich wie es geht. Das NDR-Team dokumentiert diese enorme Wandlung.
Es scheint also möglich, Kupfer auch „sauber“ abzubauen. Warum aber wird das nur so selten getan? (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Di 25.10.2022 Das Erste 477. Kampf ums Klima
Staffel 11, Folge 59Rekordhitze, Waldbrände und Überschwemmungen – die Folgen des Klimawandels sind längst spürbar. Doch während Wissenschaftler:innen immer lauter Alarm schlagen, kommt die Energiewende in Deutschland praktisch nicht voran. Nicht nur ausufernde Bürokratie verhindert den Ausbau regenerativer Energien, sondern auch ein Geflecht von aggressiven Bürgerinitiativen. Sie werden beraten von immer den gleichen spezialisierten Anwält:innen; viele haben direkte Kontakte ins rechte politische Lager der Klimawandel-Leugner. Immer wieder gelingt es ihnen, den Ausbau von Windkraftanlagen zu verzögern. So etwa beim umstrittenen Windpark im hessischen Reinhardswald, der zum propagandistischen Schlachtfeld der Energiewende geworden ist. Und dieser Kampf ist radikaler geworden. So schrecken junge Klimaaktivist:innen nicht mehr davor zurück, ihre Hände auf Autobahnen festzukleben. Und zwischen allen Fronten steht die deutsche Politik, die mehr klimaschädliche Energie einkauft, als sie eigentlich will. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Di 01.11.2022 Das Erste 478. WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet
Staffel 11, Folge 60„Eine Weltmeisterschaft zum Wohle des Fußballs?“ „Ein Motor für gesellschaftlichen Wandel in einer ganzen Region.“ „Die beste, die nachhaltigste WM aller Zeiten.“ Die Versprechen der FIFA klingen vor der umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten vollmundig. Was ist Wahrheit, was ist Wunschdenken, was Augenwischerei? Eine Woche vor Beginn der ersten Fußball-Weltmeisterschaft im arabischen Raum zeigt der Film, was wirklich hinter diesem Turnier steckt. Die Lobeshymnen von FIFA-Boss Gianni Infantino über seinen WM-Gastgeber hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack, sind doch bei der Vorbereitung dieser WM tausende Gastarbeiter gestorben.
Und wenn für ein Event hundert saftig grüne Fußballplätze in eines der wasserärmsten Länder der Erde gebaut werden, kann man sich kritischer Fragen der Welöffentlichkeit zu ökologischer Nachhaltigkeit sicher sein. Hat diese WM wirklich die Gesellschaft Katars nach vorne gebracht oder hat sie sie weiter gespalten? Man darf Zweifel haben, ob die FIFA mit diesem Turnier tatsächlich den Fußball in der Region unterstützt hat oder ob sich der Weltverband im reichsten Land der Welt vor allem fürs Finanzielle interessiert. „WM der Lügen“ schaut hinter die Hochglanzbilder, hinterfragt die flauschigen Werbebotschaften und prüft die gut aussehenden Zahlen. Ein Faktencheck für den Fußball. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 14.11.2022 Das Erste Deutsche Online-Premiere Sa 12.11.2022 ARD Mediathek 480. Sterbehilfe: Harald Mayer kämpft um seinen Tod
Staffel 11, Folge 62Für jeden Handgriff braucht er einen Pfleger, nachts, wenn er sich umdrehen will, zum Naseputzen, Zudecken, Tränentrocknen. Harald Mayer lebt in totaler Abhängigkeit. Multiple Sklerose hat ihn bewegungsunfähig gemacht. Der ehemalige Feuerwehrmann hat Angst, dass er bald weder schlucken noch atmen kann. Und trotzdem weiterleben muss. Bei vollem Bewusstsein. „Das Leben, das ich habe, das ist kein Leben mehr!“
Harald Mayer will Sterbehilfe. Die hat er nie bekommen. Denn 2015 hatte der Bundestag aktive Sterbehilfe weitgehend verboten. Doch das Bundesverfassungsgericht erklärte dieses Gesetz später für grundrechtswidrig, der Bundestag muss die Sterbehilfe nun neu regeln. Darauf hofft Harald Mayer. Der Schwerstkranke kämpft seit Jahren vor Gericht um die Herausgabe eines Medikaments, das ihn sanft im Kreis seiner Familie entschlafen ließe. Einer Sterbehilfe-Organisation möchte er sich nicht anvertrauen.
Karl-Heinz Pantke wollte nie sterben, obwohl er nicht einmal mehr den kleinen Finger bewegen konnte: Locked-in-Syndrom lautete die Diagnose vor fast 30 Jahren. Doch der Physiker kämpfte sich zurück ins Leben, schafft es mittlerweile allein bis in den vierten Stock seiner Wohnung. „Ich hatte heftige Suizidgedanken. Und bin froh, dass mir niemand geholfen hat.“ Pantke ist gegen eine Liberalisierung der Sterbehilfe: „Sie sollte per Gesetz stark eingeschränkt sein.“
Käthe Nebel glaubt nicht, dass der Bundestag Sterbehilfe frei zugänglich machen wird. Die ziemlich fitte 91-Jährige will aber nicht eines Tages in die Schweiz fahren müssen, um selbstbestimmt sterben zu dürfen. Deshalb übt sie, so makaber das klingen mag, den Freitod ohne Hilfe: in ihrem Schlafzimmer, mit einem Glas in der Hand und einer Plastiktüte über dem Kopf. „Der Suizid ist mein letzter Ausweg, wenn es unerträglich wird. Und den soll man mir überlassen. Und mir nicht erschweren. Ich bin empört!“
Die vielfach preisgekrönte Autorin Tina Soliman hat den unheilbar kranken Harald Mayer vier Jahre lang mit der Kamera bei seinem Kampf um einen selbstbestimmten Tod begleitet. Entstanden ist ein eindringlicher, oft sehr berührender Film, der die Sterbehilfe aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 21.11.2022 Das Erste Deutsche Online-Premiere Sa 19.11.2022 ARD Mediathek 481. Ein Jahr für Deutschland? – Der Streit um die Dienstpflicht
Staffel 11, Folge 63Als die Pflicht zum Wehr- und zivilen Ersatzdienst für junge Männer im Jahr 2011 ausgesetzt wurde, waren nicht alle glücklich. Und so wird seither mal mehr, mal weniger heftig über die Frage gestritten, ob der Staat junge Menschen für eine bestimmte Zeit nicht doch zu einem Dienst für die Allgemeinheit verpflichten sollte. Gerade gehen die Wogen besonders hoch, seit Bundespräsident Steinmeier eine solche Dienstpflicht fordert und die CDU diese inzwischen auf einem Parteitag als sogenanntes „Gesellschaftsjahr“ beschlossen hat. Auch die Idee der Landesverteidigung durch eine Wehrpflichtigen-Armee gewinnt mit der „Zeitenwende“ und dem Krieg in der Ukraine an Zustimmung. Und was den Zivildienst betrifft, so bedauern viele dessen Ende; denn der „Wehr-Ersatz“ hatte sich damals zu einer anerkannten sozialen Institution bewährt.
Die Leerstelle ist bis heute spürbar in der Dienstpflicht-Debatte. Kann ein Gemeinwohljahr für Männer und Frauen den Zusammenhalt stärken? Und sollte die junge Generation dazu gezwungen werden? Die Dokumentation „Dienen für Deutschland? – Der Streit ums Gemeinwohljahr“ lässt Gegner und Befürworter zu Wort kommen. Was sagen eigentlich 16-Jährige zu einer möglichen Einberufung zu Pflichtjahr oder Wehrdienst? Und was prominente Ex-Zivis wie Kurt Krömer, Campino, Harald Schmidt oder auch Politiker wie Annegret Kramp-Karrenbauer? Die ehemalige CDU-Chefin entflammte 2018 die Debatte, die bis heute immer wieder auflodert. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Di 06.12.2022 Das Erste Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 03.11.2022482. Pornoland Deutschland – Von Süchtigen und Profiteuren
Staffel 11, Folge 64 (45 Min.)Sex sells, vor allem im Internet – und vor allem in Deutschland! 2,6 Millionen Euro Umsatz wird weltweit pro Tag mit Internet-Pornografie gemacht. Deutschland liegt laut einer Studie von SimilarWeb mit 12,5 Prozent seines Datenverkehrs ganz weit vorn im Porno-Konsum – noch vor den USA mit 8,3 Prozent. Die Folgen sind fatal: Schätzungen zufolge sind etwa 500.000 Menschen in Deutschland pornosüchtig, das heißt, sie bekommen aufgrund ihrer sexuellen Störung ihr Leben nicht mehr in den Griff. Doch wie konnte es soweit kommen, und warum ist ausgerechnet Deutschland besonders betroffen?
Die Dunkelziffer ist hoch, kaum jemand spricht offen über das Tabuthema.
Die Dokumentation begleitet Betroffene bei ihrem Kampf gegen die Krankheit und forscht nach ihren Ursachen. Liegt es daran, dass junge Menschen immer früher Kontakt zur Pornographie bekommen, zum großen Teil schon vor den ersten eigenen sexuellen Erfahrungen?
Der Film schaut auch hinter die Kulissen und taucht ein in die Welt der Camgirls und des Porno-Business’. Wie funktioniert das Geschäftsmodell, das hinter dem Online-Geschäft mit der Lust steht? Aus der Sicht profilierter Forscher und Therapeuten zum Thema sind die Betroffenen Opfer knallharter Datenkraken, die von einer schweren Krankheit profitieren, indem sie das Verhalten ihrer Kunden gezielt ausforschen und die Sucht so mit passgenauen Angeboten immer weiter anfüttern. Hinzukommt, dass einige Plattformen oftmals zu wenig gegen Missbrauch von Bildern unternehmen. Regelmäßig werden Videos ohne Einwilligung der Abgebildeten hochgeladen, oder sie sind schon ohne ihr Einverständnis entstanden. Und so werden damit nicht nur Bild- und Persönlichkeitsrechte verletzt, sondern auch immer wieder echter Missbrauch indirekt unterstützt.
Der Film stellt die Frage nach der Verantwortlichkeit und nach den Lücken im Gesetz. Wie kann es sein, dass sowohl der Jugendschutz als auch die Persönlichkeitsrechte im Internet in Deutschland immer wieder systematisch ausgehebelt werden? (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 12.12.2022 Das Erste
zurück
Erinnerungs-Service per
E-Mail